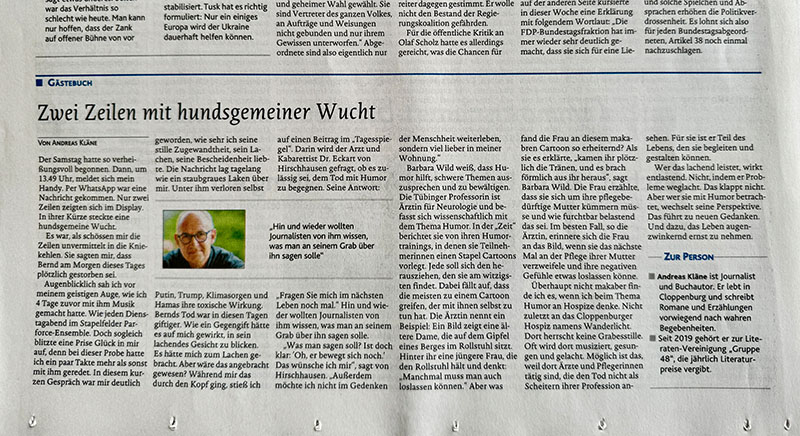Gastkolumne in OM-Medien am 27. April
Tausende um mich herum. Dicht gedrängt. Keiner sagt etwas. Weit und breit nichts als kollektiv starres Stieren nach vorne. So, als dürfte hier, vor dem Capitol in Washington, niemand verpassen, was im nächsten Moment geschehen soll. Dann Bewegung zwischen den mittleren Säulen des Portals. Donald Trump betritt eine Bühne. In deren Zentrum hält er inne. Die Luft fängt an zu brennen. Dann das Unfassbare: Dieser Mann geht auf die Knie. Und mit Blick auf seine gefalteten Hände sagte er: „Ich bin hier, um euch um Vergebung zu bitten und um Dank zu sagen. Meinen Dank an alle, die mir ihre Stimme verwehrt haben. Denn ihr seid es, die mich und die Nation vor mir geschützt haben.“
Mehr habe ich nicht mitbekommen. Mein Wecker bimmelte mich in den Wachzustand. Macht aber nichts, man kann ja auch hellwach weiterträumen. Zum Beispiel von Demut und Dankbarkeit. Ich weiß, zwei Begriffe, die heutzutage etwas verstaubt klingen. Wer demütig auf die Knie fällt, so die verbreitete Auffassung, knickt ein. Wer sich nie beugt, gewinnt jeden Kampf und wird von aufblickenden Heerscharen erhöht.
Kniefälle sind nicht en vogue und gelten schon gar nicht als cool. Und doch gibt es einen Kniefall, der in besonderer Weise Geschichte gemacht hat. 1970 war der damalige Kanzler Willy Brandt nach Warschau gereist. Er wollte einen Vertrag zwischen Polen und Deutschland unterzeichnen. Außerdem war er gekommen, um einen Kranz am Ehrenmal des Warschauer Ghettos niederzulegen. Dann passierte es: Brandt fiel auf die Knie, faltete seine Hände. Keine halbe Minute lang, aber es war eine gefühlte Ewigkeit. Das war nicht geplant, aber es bewegte und überzeugte, wie nur eine Herzensangelegenheit es kann.
Das zu tun, brauchte Mut. Und zwar den einer ganz bestimmten Art: Sie heißt Demut. Der Autor Tobias Hürter nennt dieses Verhalten in der Wochenzeitung „Die Zeit“ „eine große Geste, nicht weil Brandt sich selbst mit ihr groß machte, sondern weil er mit ihr auf etwas Größeres verwies.“
Das ist der Punkt. Brandt konnte anerkennen, dass es etwas Größeres gibt als das eigene Ich. Und das waren für ihn die Millionen Morde seines eigenen Landes. Dies ist eine Fähigkeit, die derzeit vielen populistischen Emporkömmlingen auf den politischen Bühnen abgeht. Sie halten Demut für eine Untugend, die allenfalls blöd parierenden Schafen gut steht. Demut ist für sie mit Freiheit und Selbstbestimmung nicht unter einen Hut zu bringen.
Doch wer demütig seinen Blick zum Boden richten kann, kann sich erden. So einer ist bereit, seine Stärken und Schwächen ebenso zu betrachten wie seine lichtvollen und dunklen Seiten. Er kann akzeptieren, dass die Welt sich nicht um ihn selbst dreht. Demut bedeutet dann, so Tobias Hürter, auf Distanz zu gehen zu den eigenen Zielen, Stärken und Ängsten. „Sie ist eine Art von Realismus. Ein Gegenkonzept zum Egozentrismus.“ Und somit ist Demut eine Voraussetzung für gelingende Gemeinschaft. In solch einem Umfeld kann Dankbarkeit wachsen. Sie zu haben, fühlt sich nicht einfach nur gut an. Sie bringt Menschen auch in Beziehung zu anderen. Und somit ist sie gesund für die Gesellschaft.