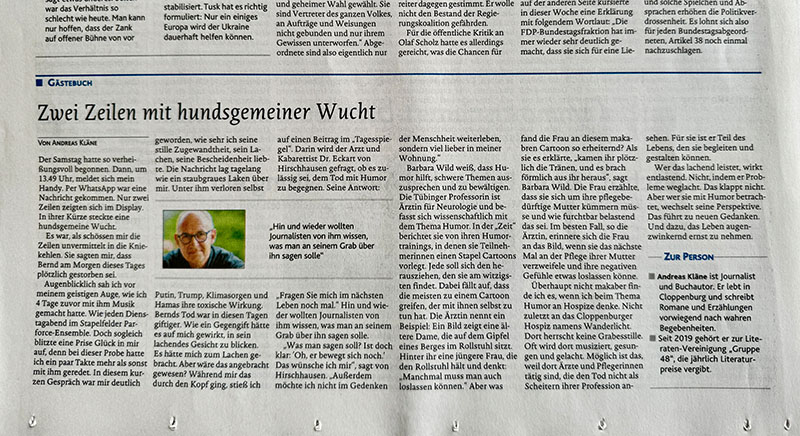Gastkolumne in OM-Medien am 20. Juli
Ich habe überhaupt nichts gegen Geheimnisse. Jeder sollte eins haben. Meinetwegen auch zwei oder drei. Da bin ich tolerant. Jedenfalls so gut wie immer. Bin ich allerdings mit Auto oder Rad unterwegs, kommt sie mir abhanden, meine Toleranz. Sie gibt dann plötzlich Gas und macht sich von der Piste. Mir ist auch klar, warum: Für ihren Geschmack sind es einfach viel zu viele Geheimniskrämer, die auf deutschen Straßen unterwegs sind. Lauter Menschen, die verheimlichen, ob sie im nächsten Moment links oder rechts abbiegen wollen. Nicht, dass die keinen Blinker beziehungsweise intakten Arm hätten. Haben sie. Allerdings auch ihr Geheimnis. Und das hütet laut ADAC jeder dritte Autofahrer. Mindestens.
Was all diese Fahrerinnen und Fahrer uns von sich verraten, ist nichts als ein Vielleicht. Vielleicht fahren sie geradeaus. Vielleicht auch nicht. Da ich dagegen nichts tun kann, sehe ich gespannt meinem nächsten Überholmanöver entgegen. Stelle mir vor, links rüber zu ziehen. Vom Gegenverkehr droht keine Gefahr, noch ist er ja winzig wie ein Stecknadelkopf. Mit Blick auf die rechte Spur muss ich jedoch mit allem rechnen. Dort ist zwar kein Blinken zu entdecken, aber was heißt das schon?!
Ich gebe Gas. Meine Augen gehen jetzt getrennte Wege. Mein linkes klebt auf dem, was sich vor mir nähert, mein rechtes auf den Autos, die hoffentlich dort bleiben, wo sie sind: rechts. Mir ist klar, dass mich dieser Schielblick ziemlich wenig attraktiv aussehen lässt. Aber egal, mich sieht ja keiner. Was mir auffällt, ist, dass ich in solchen Momenten doch tatsächlich Sympathie für Menschen entdecke, die sich am rechten Rand befinden und dort bleiben. Doch immer dann fängt in meinem Kopf etwas an zu blinken. Es ist das Wort „vielleicht“. Vielleicht zieht von rechts doch noch einer links rüber. Vielleicht geht alles gut.
Manchmal weiß ich nicht so recht, was ich von diesem Vielleicht halten soll. Es hat halt so unterschiedliche Gesichter. Wenn zum Beispiel ein Neuer in einen Verein kommt, um mal hineinzuschnuppern, und man ihn einlädt, einzutreten, lautet die Antwort allzu oft: „Vielleicht.“ Auch wenn ich einen Handwerker bitte, meinen Dachschaden möglichst noch vor dem nächsten Regen zu beheben, muss ich mich auf ein Vielleicht einstellen. Was dann bleibt, ist der schale Eindruck, dass jemand sich nicht festlegen will. Auf ihn ist ebenso wenig Verlass wie auf notorische Nichtblinker. Aber wo Verlässlichkeit fehlt, entsteht und hält keine Beziehung.
Doch im Wort “vielleicht“ steckt nicht nur Schlechtes. Es besteht ja aus zwei Wörtern: aus „viel“ und aus „leicht“. Somit bedeutet „vielleicht“, dass etwas mit viel Leichtheit, also sehr leicht möglich ist. Und das kann mich durchaus positiv in Spannung versetzen. Zum Beispiel dann, wenn ich mir sage, dass vielleicht schon heute das Paket ankommt, auf das ich mich schon seit Tagen freue. „Vielleicht“ hat also auch die Kraft, Hoffnung zu spendieren.
Und ja, ich glaube, ich kann sie schon spüren, diese Hoffnung darauf, dass es jetzt bei ein paar Nichtblinkern anfängt zu blinken. Das wünsche ich mir nicht nur für mich, auch für sie. Denn es lohnt sich nicht, sich mit Geheimnissen in den Verkehr zu wagen. Es sei denn, man sagt sich, dass Geheimnisse am sichersten bei Toten bewahrt sind.