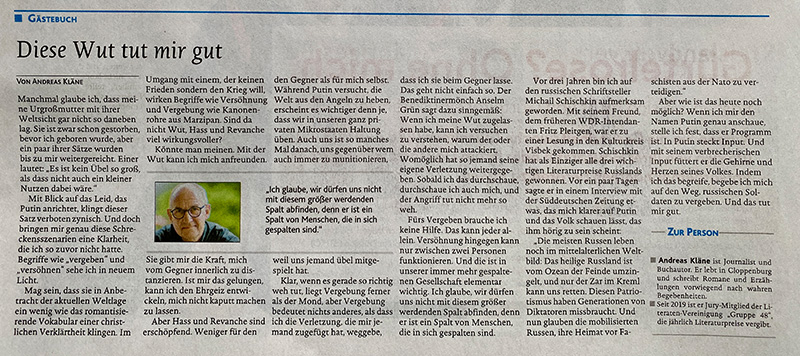
Manchmal glaube ich, dass meine Urgroßmutter mit ihrer Weltsicht gar nicht so daneben lag. Sie ist zwar schon gestorben, bevor ich geboren wurde, aber ein paar ihrer Sätze wurden bis zu mir weitergereicht. Einer lautet: „Es ist kein Übel so groß, als dass nicht auch ein kleiner Nutzen dabei wäre.“
Mit Blick auf das Leid, das Putin anrichtet, klingt dieser Satz verboten zynisch. Und doch bringen mir genau diese Schreckensszenarien eine Klarheit, die ich so zuvor nicht hatte. Begriffe wie „vergeben“ und „versöhnen“ sehe ich in neuem Licht. Mag sein, dass sie in Anbetracht der aktuellen Weltlage ein wenig wie das romantisierende Vokabular einer christlichen Verklärtheit klingen. Im Umgang mit einem, der keinen Frieden sondern den Krieg will, wirken Begriffe wie Versöhnung und Vergebung wie Kanonenrohre aus Marzipan. Sind da nicht Wut, Hass und Revanche viel wirkungsvoller?
Könnte man meinen. Mit der Wut kann ich mich anfreunden. Sie gibt mir die Kraft, mich vom Gegner innerlich zu distanzieren. Ist mir das gelungen, kann ich den Ehrgeiz entwickeln, mich nicht kaputt machen zu lassen. Aber Hass und Revanche sind erschöpfend. Weniger für den den Gegner als für mich selbst.
Während Putin versucht, die Welt aus den Angeln zu heben, erscheint es wichtiger denn je, dass wir in unseren ganz privaten Mikrostaaten Haltung üben. Auch uns ist so manches Mal danach, uns gegenüber wem auch immer zu munitionieren, weil uns jemand übel mitgespielt hat. Klar, wenn es gerade so richtig weh tut, liegt Vergebung ferner als der Mond, aber Vergebung bedeutet nichts anderes, als dass ich die Verletzung, die mir jemand zugefügt hat, weggebe, dass ich sie beim Gegner lasse. Das geht nicht einfach so. Der Benediktinermönch Anselm Grün sagt dazu sinngemäß: Wenn ich meine Wut zugelassen habe, kann ich versuchen zu verstehen, warum der oder die andere mich attackiert. Womöglich hat so jemand seine eigene Verletzung weitergegeben. Sobald ich das durchschaue, durchschaue ich auch mich, und der Angriff tut nicht mehr so weh.
Fürs Vergeben brauche ich keine Hilfe. Das kann jeder allein. Versöhnung hingegen kann nur zwischen zwei Personen funktionieren. Und die ist in unserer immer mehr gespaltenen Gesellschaft elementar wichtig. Ich glaube, wir dürfen uns nicht mit diesem größer werdenden Spalt abfinden, denn er ist ein Spalt von Menschen, die in sich gespalten sind.
Vor drei Jahren bin ich auf den russischen Schriftsteller Michail Schischkin aufmerksam geworden. Mit seinem Freund, dem früheren WDR-Intendanten Fritz Pleitgen, war er zu einer Lesung in den Kulturkreis Visbek gekommen. Schischkin hat als Einziger alle drei wichtigen Literaturpreise Russlands gewonnen. Vor ein paar Tagen sagte er in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung etwas, das mich klarer auf Putin und das Volk schauen lässt, das ihm hörig zu sein scheint: „Die meistem Russen leben noch im mittelalterlichen Weltbild: Das heilige Russland ist vom Ozean der Feinde umzingelt, und nur der Zar im Kreml kann uns retten. Diesen Patriotismus haben Generationen von Diktatoren missbraucht. Und nun glauben die mobilisierten Russen, ihre Heimat vor Faschisten aus der Nato zu verteidigen.“
Aber wie ist das heute noch möglich? Wenn ich mir den Namen Putin genau anschaue, stelle ich fest, dass er Programm ist. In Putin steckt Input. Und mit seinem verbrecherischen Input füttert er die Gehirne und Herzen seines Volkes. Indem ich das begreife, begebe ich mich auf den Weg, russischen Soldaten zu vergeben. Und das tut mir gut.


